Flucht
Eine Menschheitsgeschichte
Buchrezension von Peggy Mihan
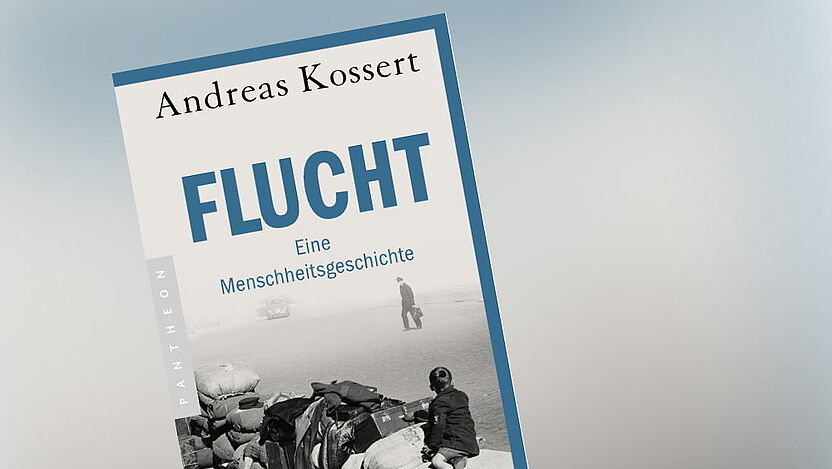
„Jeder kann morgen ein Flüchtling sein“ – so beginnt Andreas Kossert sein Buch. Es bedarf keines besonderen Spannungsaufbaus, um die Lesenden von der ersten Seite an in seinen Bann zu ziehen. Zu allen Zeiten, an allen Orten der Erde, erlebten und erleben Menschen Herabsetzung, Ausgrenzung, Gewalt und fliehen oder werden vertrieben. Die dabei gemachten Erfahrungen gleichen sich – sei es im zaristischen Russland, in Ostpreußen, Palästina, Indien, Vietnam, Ruanda oder Syrien.
Schmerzhaft ist die Beobachtung, dass erfahrenes Leid eine Gesellschaft nicht automatisch dazu bringt, alles daran zu setzen, Ähnliches in Zukunft zu verhindern. Die Spirale von Gewalt und Gegengewalt dreht sich anscheinend endlos weiter, solange Menschen nicht bereit sind anzuerkennen, dass es „die“ Flüchtlinge niemals gab und geben wird. In diesem Buch bekommen sie ein Gesicht und einen Namen. Hinter geschichtlichen Fakten und Zahlen stehen immer individuelle Schicksale.
Diese stehen im Mittelpunkt des Buches und die Betroffenen kommen selbst zu Wort. Kossert zeigt eindringlich, was die von Menschen gemachten nationalen, religiösen oder ethnischen Unterschiede auslösen können und wie sie letztlich angesichts des universellen Leids der Flucht in den Hintergrund treten.
Begriffe wie „Heimat“ oder die Unterscheidung zwischen „Flüchtling“ und „Geflüchtete“ werden kritisch und tiefgehend beleuchtet – sprachlich, historisch und politisch.
Der Bogen spannt sich von biblischen Überlieferungen über die Vormoderne, die Sklaverei und die Neuzeit bis zur Gegenwart. Besonders eindrucksvoll ist der Rückblick auf die Geschichte des Antisemitismus bis zum Ende des 19. Jahrhunderts sowie die Analyse der komplexen Zwangsmigrationen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nicht zuletzt beleuchtet Kossert auch, was es für die Zurückgebliebenen bedeutet, wenn eine in Jahrhunderten gewachsene Nachbarschaft auseinanderbricht.
Wir lesen von Fakten und Geschichten über das Weggehen, Vertrieben-Werden, die Verbannung, das Ankommen und das Weiterleben „danach“. Vom „Phantomschmerz“ der Heimatlos-Gewordenen und der Kraft, die dem Heimweh und der Erinnerung entspringt.
Die umfangreiche Bibliografie lädt zur vertiefenden Beschäftigung mit dem Themenspektrum Flucht, Vertreibung, Heimatverlust und Exil in den Bereichen Belletristik, Lyrik und internationaler Forschung ein.
Fazit: dieses Buch sollte, wo immer es in den Kontext passt, zur Pflichtlektüre erhoben werden, denn „am Umgang mit Flüchtlingen lässt sich ablesen, welche Welt wir anstreben.“ Unbedingt lesen!
Die Rezension ist ursprünglich auf mission.de, dem Blog der Organisation Evangelische Mission Weltweit erschienen.
Peggy Mihan ist als Diakonin u. a. in der Herrnhuter Brüdergemeine in Berlin
sowie für die Onlineangebote der Brüder-Unität aktiv. Sie lebt in Berlin.
In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf eine Folge des Podcast der Evangelischen Mission Weltweit hinweisen: Cecilia Pani, Projektleiterin Humanitäre Korridore Äthiopien bei Sant’Egidio stellt darin das Projekt der „Humanitären Korridore“ vor, die es Flüchtenden ermöglicht, legal und mit geringeren Gefahren für Leib und Seele Asyl in Europa zu beantragen.
Artikel veröffentlicht am 21. Februar 2025


